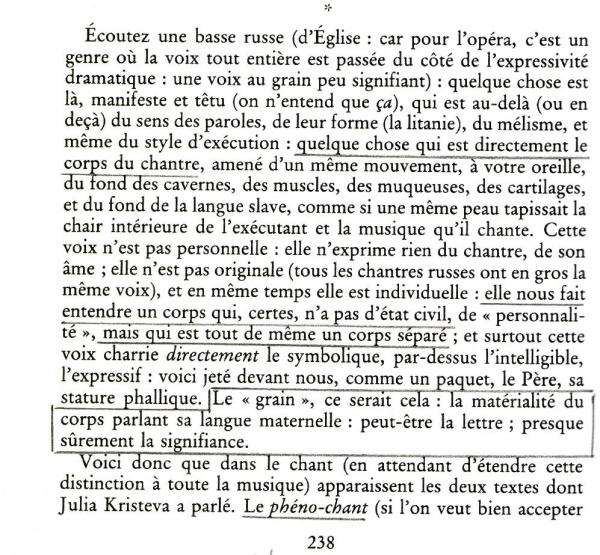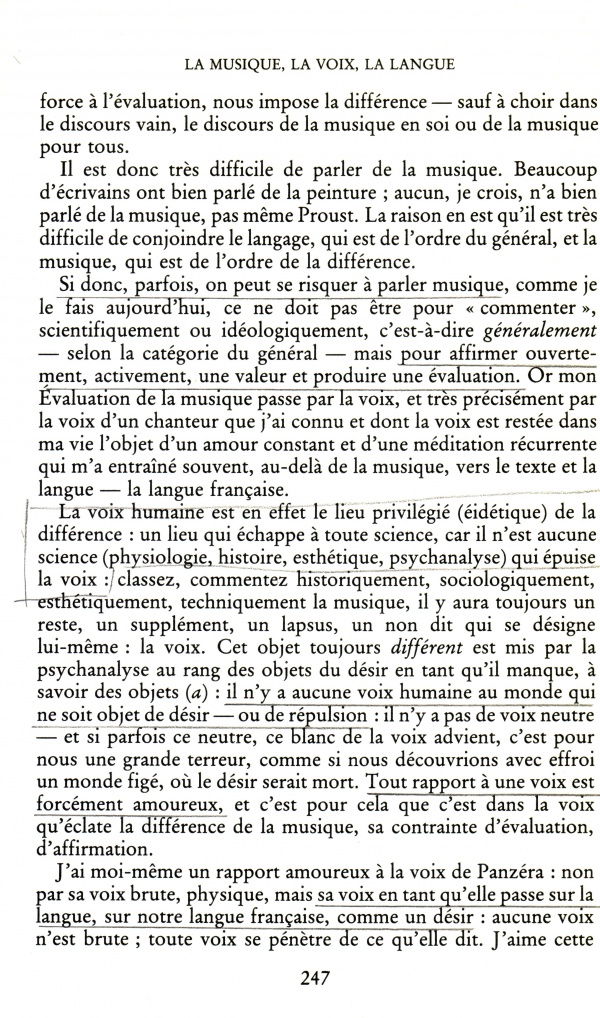Roland Barthes (mse)
Aus Philo Wiki
Roland Barthes
| 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> |
Die Rauheit der Stimme
Kate Callaghan: Some thoughts on voice and modes of listening
Hartmut Winkler, Ulrike Bergermann: Singende Maschinen und resonierende Körper
Stimmlose Sprache?
http://userpage.fu-berlin.de/~sybkram/media/downloads/Negative_Semiologie_der_Stimme.pdf Sybille Krämer: Negative Semiologie der Stimme (passim)
- Rekapitulieren wir noch einmal die Besonderheiten der Stimmlichkeit:
- Im Fluxus des Sprechens verkörpert die Stimme Ereignishaftigkeit; die Aisthesis des gesprochenen Wortes ist von irreduzibler Singularität.
- Als vollzogener Machtgestus oder als Reflex gefühlter Ohnmacht, als eindringlicher und aufdringlicher Anspruch an den anderen, ist das Register der Stimme verwoben mit einem Typus der Zwischenmenschlichkeit, dessen Nährboden weniger das Argumentieren, denn der Affekt ist.
- Als Teil der elementaren wie existentialen Leiblichkeit der Sprecher zeugt die Stimme immer auch von unserer Bedürftigkeit, der ein Begehren eigen ist, das sich an den anderen richtet. In unserer Stimmlichkeit werden wir nicht nur als ‚Essenzen‘, vielmehr als konkret situierte leibliche ‚Existenzen‘ offenbar.
- Wenn aber in der Stimme sich eine macht- und ohnmachtbezogene Form von Intersubjektivität, ein gefühlsmäßiges Gestimmtsein jenseits kognitiver Dispositionen, eine aisthetische Kraft, die nicht dem Logos zu Diensten ist, artikuliert, dann bricht sich in der Lautlichkeit Bahn, was der ‚Logosauszeichnung‘ von Sprache und Kommunikation gerade nicht subsumierbar, durch sie nicht instrumentalisierbar ist. So ist es kaum verwunderlich, daß ein Sprach- und Kommunikationskonzept, für welches das Sprechen nicht alleine durch Regelbeschreibung rationalisierbar ist, sondern überdies noch zur Springquelle von Rationalität und rationalem Verhalten avanciert, daß ein solches Konzept ohne die Reflexion der Stimmlichkeit bestens auskommt. Wie umgekehrt: Die Stimme einzubeziehen bedeutet dann, sich an einem nicht-intellektualistischen Sprachkonzept zu orientieren. Wir haben auch schon einen Wink, wie dabei methodologisch zu verfahren ist: Eine Alternative zum kognitivistischen Sprachbild zu entwerfen, heißt zuerst einmal, eine ‚performative Revision‘ seiner methodologischen Prämissen einzuleiten.
- Das ‚Bauprinzip‘ intellektualistischer Sprachtheorien ist die Unterscheidung zwischen Schema (System, Regelwerk) und Gebrauch (Aktualisierung, Realisierung). Gemäß dieser methodologischen Prämisse gehört das Lautliche nicht zur Sprache, sondern ist ‚nur‘ das Medium zum Vollzug von Sprache, die selbst dabei als medienindifferent konzipiert ist. Die theoretische Gelenkstelle einer ‚performativen Revision‘ ist es nun, daß in ihrem Rahmen Medien eben nicht mehr marginal, vielmehr konstitutiv sind. ‚Konstitutiv‘ insofern im aktualisierenden Vollzug eines Schemas dieses Schema immer auch transformiert, unterminiert oder überstiegen wird. Die Richtung, die der kreative Überschuß des Vollzuges gegenüber dem darin realisierten Muster jeweils annehmen kann, ist aber als Potential im Medium selbst angelegt.
- Aber sind die ‚Weichen‘ eines solchen Alternativprogramms nicht schon längstens gestellt? Spätestens mit der im poststrukturalistischen Diskurs – einsetzend mit Lacan – üblich gewordenen Aufwertung des Signifikanten gegenüber dem Signifikat, ist doch eine Perspektive gewonnen, in der auch die Stimme als genuiner Bestandteil sprachlichen Geschehens rehabilitierbar ist. Das ist dann der Fall, wenn wir die Stimme als materiellen Signifikanten und den Aussagegehalt der Rede als deren Signifikat deuten. Wir brauchen doch nur ‚was ein Medium ist‘ zu identifizieren mit dem materiellen Zeichenträger – und schon ist ein bequemer Zugang gewonnen, um nahezu alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Objekte, die doch im weitesten Sinne als ‚Zeichendinge‘ bzw. ‚symbolische Formen‘ qualifizierbar sind, in eine medientheoretische Perspektive zu rücken. Die Stimme wäre damit nicht länger als ein Außersprachliches marginalisiert, vielmehr als unverzichtbarer materieller Signifikant sprachlicher Semiosis rehabilitiert. Und doch: Dieser Weg führt noch nicht weit genug.
- Der Grund dafür ist, daß, was immer ein Medium ist, nicht aufgeht in dem, wozu ein ‚Signifkant‘ im Rahmen der semiotischen Beziehung zwischen Zeichenträger und Zeichenbedeutung dient. Oder, falls man doch das Medium irgendwie auf Seiten Signifkanten lokalisieren möchte: Das Medium ist dann gerade jene Dimension am Signifikanten, „die nicht zur Signifikation beiträgt.“ Das Medium durchbricht also das Modell der Semiosis. Medientheoretische Reflexionen erweisen sich damit als eine Möglichkeit, die Grenzen des semiotischen Paradigmas für Untersuchung und Reflexionkultureller Gegenstände auszuloten.
- Fassen wir diese Überlegungen zusammen: Die semiotische Wirkung der Stimme beruht weniger auf kodierter Zeichengebung und mehr auf unwillkürlicher Indexikalität. Die Stimme ist nicht einfach Symbol, sondern Spur von etwas; sie fungiert nicht einfach als Zeichen, vielmehr als Anzeichen. In dieser ihrer Indexikalität ist es begründet, daß die Stimme nicht nur spricht, sondern zeigt. Gemäß einer traditionellen Schematisierung unserer symbolischen Vermögen stehen uns zwei grundlegende Register der Zeichengebung zu Gebote: das ist das Diskursive und das Ikonische, das Sagen und das Zeigen, auch explizierbar als das Digitale und das Analoge. Wir sind gewohnt, die Sprache mit dem Diskursiven, dem Sagbaren, das Bild aber mit dem Ikonischen, dem Zeigbaren zu identifizieren. Wenn aber die Behauptung, daß mit der Stimme ein analogisch-indexikalisches Prinzip beim Sprechen wirksam wird, zutrifft, ergibt sich ein bemerkenswerter Umstand: Jenes physischpsychische Substrat des zum Laut geformten Schalls, das wie kein anderes in seiner zeitlichen Sukzessivität und Fluidität geeignet ist, sprachliche Materialität zu stiften, also der Sprache‚ einen Körper zu geben‘, wird als ein nicht-diskursives Anzeichen zur Bedingung der Möglichkeit zeichenhafter Diskursivität. Die Signifikanz der Lautsprache ist verwoben mit dem Signalcharakter des Lautlichen.
- Was es heißt, daß die Stimme nicht nur beiträgt zur Signifikanz der Rede, sondern diese auch durchbricht, erschließt sich erst einer Einstellung, die wir hier als ‚Negative Semiologie‘ kennzeichnen können. Die Maxime der Negativen Semiologie ist: Was die Stimme als Medium von Sprache und Kommunikation bewirkt, ist in zeichentheoretischen Termini hinreichend nicht mehr beschreibbar. Die Medienperspektive einzunehmen ist also ein Versuch, die in der Semiosis nicht aufgehenden Dimensionen der Lautlichkeit zutage treten zu lassen. Daher läuft die Medienperspektive – in letzter Konsequenz – darauf hinaus, die uns selbstverständliche Idee, sprachliches Tun mit einem Zeichenhandeln zu identifizieren, zu relativieren.
- Gehen wir noch einmal aus von der Materialität der mündliche Sprache: Es gibt eine mit und seit Aristoteles ‚definitiv‘ gewordene begriffliche Trias zur Kennzeichnung des Akustischen: psophos (lat. sonus) bedeutet Schall oder Geräusch; phoné (lat. vox) meint den sprachlichen Laut; phthongos (lat. sonus musicus) bezieht sich auf den musikalischen Ton.30 Die Unterscheidung zwischen sprachlichem Laut und musikalischem Ton ist also ein lang tradiertes Kulturgut. Aber ist in dieser Tradition nicht auch etwas verlorengegangen? Die Kunstpraxis der altgriechischen musiké vollzog und verstand sich als Einheit von Musik, Sprache und Tanz, kristallisiert im Bindeglied des Rhythmus als Ordnung einer Bewegung in der Zeit.31 Kann nun die konzeptuelle Aufspaltung der musiké in der Unterscheidung von Sprache und Musik auch als ein Reflex auf die Literalisierung der mündlichen Sprache durch das Alphabet gedeutet werden? Denn die phonetische Schrift mit ihrem erstmals durch die griechische Erfindung von Buchstaben für Vokale realisierten Anspruch, die mündliche Sprache vollständig in nicht weiter zerlegbare ’bedeutungslose‘ Elemente aufzuspalten, mithin die Sprache als eine Art von System aufzufassen, löst die lautsprachliche Schicht heraus aus einer kommunikativen Konstellation, in der Gestik, Mimik, Prosodie, Verbalität und Situationsbezug der Rede in holistischer Weise zusammen wirken. Auskristallisiert in einem allein zu den Augen sprechenden Schriftbild, kann die Sprache überhaupt erst zu einem Objekt von Beobachtung, Untersuchung und Reflexion und damit auch zu einem isolierbaren, solitären Medium der Kommunikation werden.
- Wenn es aber so ist, daß die phonetische Schrift zur Modellbildnerin ‚der‘ Sprache wird, – dann werden sich gerade im Begriff des ‚Lautes‘ bzw. des ‚Phonems‘ von Anbeginn Merkmale eingeschrieben haben, die nicht diejenigen der akustischen Stimme, vielmehr der visuellen Schrift sind. Die abendländische Konzeption vom Sprachlaut – das jedenfalls ist die Vermutung – ist geprägt von einem impliziten Skriptizismus. Wir können diesen Gedanken hier nicht weiter verfolgen. Uns kommt es nur auf eine Facette an, die darin besteht, daß mit der Skripturalisierung des Sprachlautes seine Entmusikalisierung eingeleitet ist. Mit der Dazwischenkunft der phonetischen Schrift wird die Sprache ihrer musikalischen Dimension entkleidet. In dieser Perspektive zeugt die Marginalisierung der Stimme daher auch von einer Eskamotierung – oder sollten wir sagen: Verdrängung? – des Musikalischen aus dem mündlichen Sprachgebrauch. Und umgekehrt: Eine Rehabilitierung der Stimmlichkeit heißt dann, die musikalische Dimension am und im Sprechen wiederzugewinnen. Das also, worin die ‚negative Semiologie der Stimme‘ die Semiotik der Sprache aufbricht, liegt in der Musikalität des Sprechens.