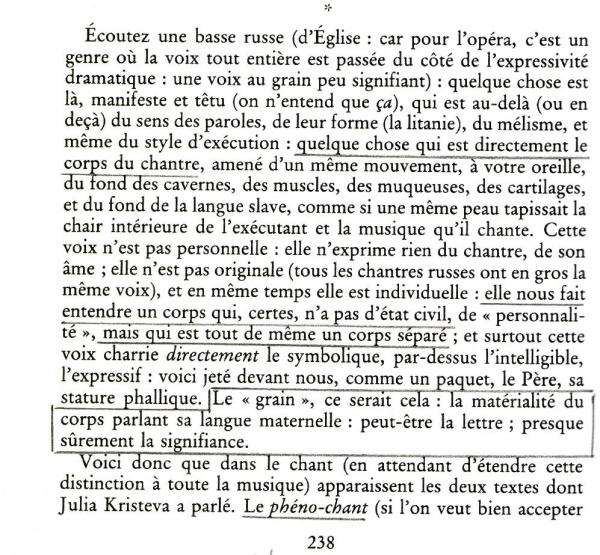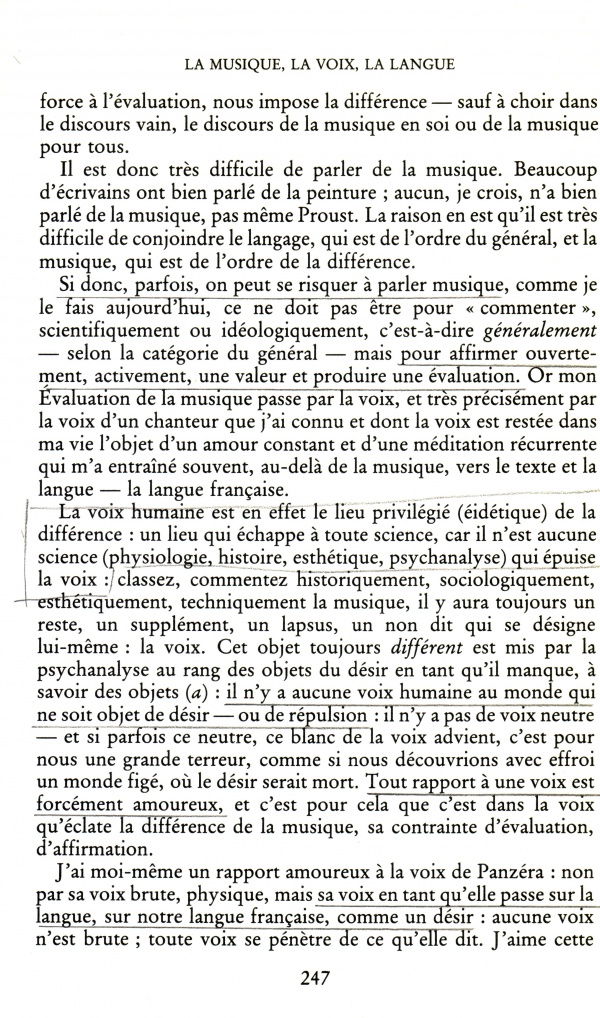Roland Barthes (mse)
| 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> | 200|180</videoflash> |
Inhaltsverzeichnis
Hilde Zadek
| <flashmp3>http://131.130.46.67/wiki_stuff/zadek-wurzeln.mp3</flashmp3> | "Ich hab' keine Ahnung" |
Einige Bemerkungen über phonetisch/phonologische Analysen: Freiheit in einigen Hinsichten (FiK)
Harvey Goldberg
| <flashmp3>http://131.130.46.67/wiki_stuff/goldberg-mitbestimmung2.mp3</flashmp3> | Harvey Goldberg über Arbeitermitbestimmung in Deutschland |
Charles Panzera
| <videoflash type="youtube">78sK4f86_8M</videoflash> |
Fischer Dieskau
| <videoflash type="youtube">c5W3qGUa9XU</videoflash> |
Roland Barthes
Die Rauheit der Stimme
Le Grain de la Voix
Auch Roland Barthes beginnt mit Kritik. Er wendet sich aber nicht gegen eine philosophische Theorie, sondern gegen das konventionelle Sprechen/Schreiben über Musik. Für seine Gedanken ist entscheidend, dass die Gegenüberstellung von Leben und Tod, Atem und Aufzeichnung ein asymmetrisches Moment hat. Es ist nicht sachgerecht, im Sprechen eine "Fülle des Sinns" anzusetzen, der ein dramatischer Verlust von Sinn in der Schrift entgegensteht. Aber es ist auch festzuhalten: der sprechende Mensch ist nicht bloß das Ausführungsorgan von Zeichenregeln. Es ist illusorisch, zu meinen, dass Menschen den Sinn von Worten daraus beziehen könnten, dass sie "in sich hineinhören". Die unmittelbare Sicherheit, dass eine Person "weiss wovon sie spricht", ist eine Leerformel. Aber das heisst nicht, dass es keinen einzigartigen Beitrag des Lebewesens zur Sinnbestimmung gibt.
In der Nähe des Schriftsystems kann es etwas geben, was "wie eine Schrift aussieht". Oder phonetisch: was wie eine Sprache klingt. (Graz, Theater am Bahnhof: ein Wechsel im Stegreif in eine Sprache, welche die Schauspieler nicht beherrschen.) Ohne zusätzliche Kenntnisse bleibt unentschieden, wie es sich verhält. Wenn aber die beiden Seiten nicht gegeneinander ausgespielt werden, entsteht ein anderer Effekt. Es wird dann nicht gefragt, wie einander Struktur und Ereignis zueinander verhalten (können). Es geht dann nicht darum, dem "überschätzten" Leben polemisch den Tod (als Ermöglichung von Sinn) gegenüberzustellen. Sondern es besteht ein Ganzes, z.B. ein Lied. Nicht Hauchen, Husten, Schluchzen und auch nicht gedruckte oder digitalisierte Symbolketten, sondern ein Ereignis, in dem jemand seine Stimme dazu einsetzt, auf musikalischem Weg sprachliche Mitteilungen zu machen.
Gegeben dieses Vorhaben lässt sich eine Dimension nennen, die Sinn verkörpert und mit allgemeinen Zeichensystemen inkommensurabel ist. Die körperliche Artikulation eines Textes ist nicht vergleichbar mit Schriftformen. So unterschiedlich eine textuelle Mitteilung ausgeprägt sein mag, es handelt sich um Variationen im Design eines Alphabets. Abgesehen von Sonderfällen betrifft das nicht den Inhalt der Mitteilung. Gesprochene und speziell gesungene Worte enthalten dem gegenüber ein Plus: ein Mensch wendet sich an andere Menschen. Aus dieser Situation kann man (im ersten Durchgang) das Leben nicht abstrahieren. Sofern es ein Mensch ist, ist (im Regelfall) gewährleistet, dass es nicht bloß wie Sprache klingt. Das romantische Lied inszeniert die Unhintergehbarkeit des verkörperten Sinns.
Kate Callaghan: Some thoughts on voice and modes of listening
- We begin to see how sound is written on the body, or rather, resonates in and through the body. I find it interesting that Barthes’ experience of Schumann could equally apply to late twentieth century dance music: the beat or rhythm is "whatever makes any site of the body flinch", this is how we can designate a "dance music" a such, and how it can connect to the "beating body". It is perhaps no coincidence that this kind of music, so connected with it audience’s "beating body" generally employs two fundamentals: a pitched voice/tune (nervous system) and a (usually unpitched) bass/beat (blood in circulation). ... "My body is to the greatest extent what everything is": and so too sound (Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible quoted in Andrews: 6). The recognition of sound as a linkage of time and space - where in Western culture we have traditionally tried to separate, and valorise one over the other - automatically provides the possibility of a linkage between many "opposites", mind~body~spirit, conscious~unconscious, me~you, us~them. No wonder then the microperceptual requires a macroperceptual to acculturate the unheard and consequently reinstate it’s "natural" philosophical boundaries!
...
- Roland Barthes named this individual voice-magic the grain of the voice. The grain is imparted in the "very precise space of the encounter between a language and a voice". In this sense, the voice is "pure indication", pure meaning to mean, pure universal transcendence. But where is the place of the voice if the hearer does not understand the language is question? The expectation of a contemporary opera audience hangs on exactly this assumption - that the grain of the voice will carry enough meaning to the ear, so that we do not need to understand the Italian/German/French/Russian.
- If this space between the sound and its meaning, or between our micro and macro perceptions of it "opens a new field of though [and]...is, therefore, singularly close to the field of meaning of pure being", it has been articulated via a body and its breath/spirit/voice. No wonder then, it is difficult to listen to or for this space in the Others voice, the "unheard of". Perhaps it is here that we begin to understand the connection between language (sound) and death. For if to experience is to comprehend, then to comprehend the space of "pure being" in a voice is also to experience its complete Otherness. It is to experience in real time the gap between the word and its sounding. The voice of an animal certainly places it, but can in no way realise that moment of discourse (Agamben: 35), hence the essential relation between death and language flashes up before us...
Hartmut Winkler, Ulrike Bergermann: Singende Maschinen und resonierende Körper
- Popmusik, dies ist die erste Linie, die wir detaillierter weiter verfolgen wollen, adressiert nicht die Köpfe, sondern die Körper. Popmusik ist Körpermusik. Die Nutzung des gesamten Klangspektrums von 20 Hz bis über die Hörschwelle von 20.000 Hz hinaus, die infernalischen Lautstärken insbesondere der Liveacts, die hohe Dynamik und das explosiv-steilflankige Hochschwingverhalten der Anlagen - all dies dient keineswegs, wie der Propagandabegriff ‘HiFi’ noch suggeriert, einer treulichen Abbildung, also einem Realismuskonzept; in klarer Weise geht es darum, die Körper als Sensorium, in ihrer Zentrierung auf die Lust, zu erreichen.
- Die Schwingung der Luft, so könnte man sagen, wird verwendet, um die Körper im wörtlichen Sinne taktil zu massieren, sie in Bewegung zu versetzen, mithilfe eines zwingenden, äußeren Rhythmus ihre inneren Rhythmen mit fortzureißen; es ist dies ein mimetisches Wirkungskonzept, in dem Sinne einer körperlichen Anverwandlung.
- Die Körper verfügen über ein Vermögen der Resonanz, und daß dieser Begriff - ‘resonare’ heißt zurück-klingen, widerhallen - aus der Sphäre des Akustischen entnommen ist, dürfte keinswegs zufällig sein. Resonanz meint ein sehr komplexes Vermögen, das zwischen dem körperlichen Innenraum und dem Außenraum, der die Körper umgibt, physio-psychische Korrespondenzverhältnisse herstellt. Diese sind auf die ‘Kanäle’ der Sinne nur vordergründig zu reduzieren. Wenn wir Popmusik eher mit dem Bauchfell als mit den Ohren hören oder der Schlag einer Bassdrum uns buchstäblich in die Knochen fährt, so antwortet der Körper in seiner komplizierten Gesamtheit. Und auch Passivität und re-aktive Aktivität werden auf komplexe Weise verschränkt. Einerseits genießen wir es, wie Raulff bereits 1979 geschrieben hat, im Soundgewitter der Discothek „aufgeladen und beschleunigt zu werden - wie ein Partikel [...] ein Ding“, wir genießen eine lustvolle Passivität, eine Anverwandlung ans Tote, die für mimetische Vorgänge nicht untypisch ist. Und andererseits re-agiert der Körper gerade hier als lebendiger Körper; das verzweigte System innerkörperlicher Wahrnehmung, die vielfältigen Resonanzen auch innerhalb dieses Binnenraums, münden in körperliche Reaktionen, in den Drang, den aufgenommenen Reiz körperlich auszuagieren, und im Fall der Tanzmusik in Tanz.
- Spektakulär nun ist, daß all diese ontogenetisch wie phylogenetisch sehr tiefliegenden Prozesse ausgelöst werden - durch Maschinen. Durch avancierte Maschinen, die keine andere Aufgabe haben als eben diese Prozesse auszulösen und zu bearbeiten. Die Körper und die Maschinen interagieren, und zwar ‘unmittelbar’ auf der Basis einer gemeinsam-lustvollen Materialität. Aus diesem Pakt ausdrücklich ausgeschlossen bleiben die Köpfe. Die Köpfe, denen die Maschinen entstammen und denen sie ansonsten so nachhaltig verpflichtet sind, werden umgangen, stillgestellt, ausgeblendet; das ganze Arrangement zielt darauf ab, die übermächtige Ratio, die ahnt, daß sie isoliert keine ist. zumindest aus dieser Medienanordnung pfleglich herauszuhalten.
...
- Auch die Stimme, die wir meistens als Trägerin von Text wahrnehmen und so eher kaum wahrnehmen, macht Sound: in Schreien, Lallen, Brüllen. Roland Barthes hat in seinem Begriff der „Rauheit der Stimme“ versucht, etwas jenseits der üblichen Bedeutungen des Gesangs mit Bezug auf den singenden Körper zu fassen. Beim Singen werden die Schwingungen durch Atmung, Stimmlippen usw. in ein bestimmtes Harmoniespektrum kanalisiert und in der Regel mit Sprache verbunden; der singende Körper wurde darauf trainiert, Theater und Oper zu ‘füllen’. „Stimme“ ist also die Bezeichnung für Anatomie und Ausdrucksmodus, Ergebnis eines Zusammenspiels verschiedener Körperorgane mit dem Medium Luft, das meßbar ist in Frequenzen oder Dezibel. Der (rückwirkend betrachtet) „technische Teil“ der Stimme und seine Koppelung mit dem Sinnigen (dem u.a. in Sprache Codierten, der Hermeneutik Zugänglichen) und dem Sound veränderte sich mit den Medien der Schallaufzeichnung, vor allem durch die Einführung des elektrischen Aufnahmeverfahrens um 1925, dieser „Voraussetzung für den Popstar im modernen Sinne“: „Die Verstärkung des Tons, die bis vor kurzem eine Angelegenheit der Stimme selbst gewesen war, der Gesangstechnik, wurde nunmehr ganz von der Apparatur besorgt“.
- So scheint mit zunehmender apparativer Übersetzung die Künstlichkeit der Gesangstechnik zu verschwinden; schon die Fülle der Stimme wird zu einer Angelegenheit der Aufnahmetechnik, der Aussteuerung und Mischung, und die begleitenden Kennzeichen geflüsterten oder geschmetterten Gesangs werden so, losgelöst von der räumlichen Vortragssituation, nicht nur mit anderen Konnotationen von Nähe und Ferne besetzbar, sondern auch die sinnliche Erfahrung von Nähe und Ferne überhaupt wird technisch generierbar. Wer etwa raunt beim Singen, wirkt wie ganz nah am Ohr des Hörers/der Hörerin. ... Gleichzeitig zeigt sich hier ein Problem: In der selbstverständlichen Rede von ‘weniger künstlich’ und ‘realistisch’ unterstellt der Text ein weiteres Mal, Apparatfreiheit und körperliche Erotik seien selbstverständlich verbunden. ... Theo van Leeuwen hat die Entkoppelung von Distanzwahrnehmung und auditiven Techniken ohne Verlustmetaphorik als neuen sozialen Erfahrungsraum beschrieben und nennt Chervels „falsche Intimität“ einfach eine offensichtlich „unmögliche“ - außerdem sei ein schreiender Rocksänger eben auch bequem in der Intimität eines Walkman zu hören. Daß die Künstlichkeit einer solchen Authentifizierung ihren selbstreflexiven Reiz hat, zeigen Aufnahmen wie Madonnas Tell Me, in denen die Stimme deutlich elektronisch bearbeitet ist, durchsetzt von ebenso deutlichen Atemzügen. Technik, Unnatur, Unwahrheit: dieser Konnex wurde aufgebrochen, als die Geräte daran gingen, selbst Musik zu machen und so ‘zu singen’ begannen.
| <videoflash type="youtube">NK5jXSlQlcw</videoflash> |
Sybille Krämer: Negative Semiologie der Stimme (passim)
- Rekapitulieren wir noch einmal die Besonderheiten der Stimmlichkeit:
- Im Fluxus des Sprechens verkörpert die Stimme Ereignishaftigkeit; die Aisthesis des gesprochenen Wortes ist von irreduzibler Singularität.
- Als vollzogener Machtgestus oder als Reflex gefühlter Ohnmacht, als eindringlicher und aufdringlicher Anspruch an den anderen, ist das Register der Stimme verwoben mit einem Typus der Zwischenmenschlichkeit, dessen Nährboden weniger das Argumentieren, denn der Affekt ist.
- Als Teil der elementaren wie existentialen Leiblichkeit der Sprecher zeugt die Stimme immer auch von unserer Bedürftigkeit, der ein Begehren eigen ist, das sich an den anderen richtet. In unserer Stimmlichkeit werden wir nicht nur als ‚Essenzen‘, vielmehr als konkret situierte leibliche ‚Existenzen‘ offenbar.
- Wenn aber in der Stimme sich eine macht- und ohnmachtbezogene Form von Intersubjektivität, ein gefühlsmäßiges Gestimmtsein jenseits kognitiver Dispositionen, eine aisthetische Kraft, die nicht dem Logos zu Diensten ist, artikuliert, dann bricht sich in der Lautlichkeit Bahn, was der ‚Logosauszeichnung‘ von Sprache und Kommunikation gerade nicht subsumierbar, durch sie nicht instrumentalisierbar ist. So ist es kaum verwunderlich, daß ein Sprach- und Kommunikationskonzept, für welches das Sprechen nicht alleine durch Regelbeschreibung rationalisierbar ist, sondern überdies noch zur Springquelle von Rationalität und rationalem Verhalten avanciert, daß ein solches Konzept ohne die Reflexion der Stimmlichkeit bestens auskommt. Wie umgekehrt: Die Stimme einzubeziehen bedeutet dann, sich an einem nicht-intellektualistischen Sprachkonzept zu orientieren.
- Das ‚Bauprinzip‘ intellektualistischer Sprachtheorien ist die Unterscheidung zwischen Schema (System, Regelwerk) und Gebrauch (Aktualisierung, Realisierung). Gemäß dieser methodologischen Prämisse gehört das Lautliche nicht zur Sprache, sondern ist ‚nur‘ das Medium zum Vollzug von Sprache, die selbst dabei als medienindifferent konzipiert ist. Die theoretische Gelenkstelle einer ‚performativen Revision‘ ist es nun, daß in ihrem Rahmen Medien eben nicht mehr marginal, vielmehr konstitutiv sind. ‚Konstitutiv‘ insofern im aktualisierenden Vollzug eines Schemas dieses Schema immer auch transformiert, unterminiert oder überstiegen wird. Die Richtung, die der kreative Überschuß des Vollzuges gegenüber dem darin realisierten Muster jeweils annehmen kann, ist aber als Potential im Medium selbst angelegt.
- Aber sind die ‚Weichen‘ eines solchen Alternativprogramms nicht schon längstens gestellt? Spätestens mit der im poststrukturalistischen Diskurs – einsetzend mit Lacan – üblich gewordenen Aufwertung des Signifikanten gegenüber dem Signifikat, ist doch eine Perspektive gewonnen, in der auch die Stimme als genuiner Bestandteil sprachlichen Geschehens rehabilitierbar ist. Das ist dann der Fall, wenn wir die Stimme als materiellen Signifikanten und den Aussagegehalt der Rede als deren Signifikat deuten. Wir brauchen doch nur ‚was ein Medium ist‘ zu identifizieren mit dem materiellen Zeichenträger – und schon ist ein bequemer Zugang gewonnen, um nahezu alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Objekte, die doch im weitesten Sinne als ‚Zeichendinge‘ bzw. ‚symbolische Formen‘ qualifizierbar sind, in eine medientheoretische Perspektive zu rücken. Die Stimme wäre damit nicht länger als ein Außersprachliches marginalisiert, vielmehr als unverzichtbarer materieller Signifikant sprachlicher Semiosis rehabilitiert. Und doch: Dieser Weg führt noch nicht weit genug.
- Der Grund dafür ist, daß, was immer ein Medium ist, nicht aufgeht in dem, wozu ein ‚Signifkant‘ im Rahmen der semiotischen Beziehung zwischen Zeichenträger und Zeichenbedeutung dient. Oder, falls man doch das Medium irgendwie auf Seiten Signifkanten lokalisieren möchte: Das Medium ist dann gerade jene Dimension am Signifikanten, „die nicht zur Signifikation beiträgt.“ Das Medium durchbricht also das Modell der Semiosis. Medientheoretische Reflexionen erweisen sich damit als eine Möglichkeit, die Grenzen des semiotischen Paradigmas für Untersuchung und Reflexionkultureller Gegenstände auszuloten.
- Fassen wir diese Überlegungen zusammen: Die semiotische Wirkung der Stimme beruht weniger auf kodierter Zeichengebung und mehr auf unwillkürlicher Indexikalität. Die Stimme ist nicht einfach Symbol, sondern Spur von etwas; sie fungiert nicht einfach als Zeichen, vielmehr als Anzeichen. In dieser ihrer Indexikalität ist es begründet, daß die Stimme nicht nur spricht, sondern zeigt. Gemäß einer traditionellen Schematisierung unserer symbolischen Vermögen stehen uns zwei grundlegende Register der Zeichengebung zu Gebote: das ist das Diskursive und das Ikonische, das Sagen und das Zeigen, auch explizierbar als das Digitale und das Analoge. Wir sind gewohnt, die Sprache mit dem Diskursiven, dem Sagbaren, das Bild aber mit dem Ikonischen, dem Zeigbaren zu identifizieren. Wenn aber die Behauptung, daß mit der Stimme ein analogisch-indexikalisches Prinzip beim Sprechen wirksam wird, zutrifft, ergibt sich ein bemerkenswerter Umstand: Jenes physischpsychische Substrat des zum Laut geformten Schalls, das wie kein anderes in seiner zeitlichen Sukzessivität und Fluidität geeignet ist, sprachliche Materialität zu stiften, also der Sprache‚ einen Körper zu geben, wird als ein nicht-diskursives Anzeichen zur Bedingung der Möglichkeit zeichenhafter Diskursivität. Die Signifikanz der Lautsprache ist verwoben mit dem Signalcharakter des Lautlichen.
- Die Stimme ist Trägerin bedeutsamer Mitteilungen und sie ist selbst eine Mitteilung. Das spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab.
- die Artikulationen bilden die Grundlage einer verständigen ´(Re-)Konstruktion von Bedeutungen
- das Mittel der Artikulation kann selbst zu einer solchen Grundlage werden (Hilde Zadek)
- Das sind zwei "Ausdrucksebenen". Man könnte das damit vergleichen, dass eine Schrift nicht nur textuelle Inhalte mitteilt, sondern auch spezielle visuelle Eigenschaften besitzt, die ihrerseits inhaltlich deutbar sind. Darin kann die Besonderheit der Stimme nicht liegen. Wie Andreas Kirchner auf der Diskussionsseite ausführt, hat jedes Medium den Aspekt, als solches mitgeteilter Inhalt zu sein.
- Die Stimme ist Trägerin bedeutsamer Mitteilungen und sie ist selbst eine Mitteilung. Das spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab.
- Sybille Krämer fügt dem hier dargestellten Zusammenhang einen zusätzlichen Gedanken hinzu. Sie macht aus der Rolle der Stimme als "ikonischer" Bedeutungsträgerin eine Bedingung der Möglichkeit zeichenhafter Diskursivität. Aber zwischen der Möglichkeit zur Doppelverwendung des Phänomens "Stimme" und der Frage nach der Ermöglichung bedeutungshafter Mitteilung besteht ein systematischer Unterschied. Auch die Schrift kann als "Bedingung der Möglichkeit zeichenhafter Diskursivität" angesprochen werden und auch sie kann ikonischen Charakter annehmen. Den Unterschied zwischen ihr und der Stimme habe ich in den obenstehenden Bemerkungen zu Roland Barthes anzudeuten versucht. Ihn hat S. Krämer in diesem Absatz nicht im Blick.
- Was es heißt, daß die Stimme nicht nur beiträgt zur Signifikanz der Rede, sondern diese auch durchbricht, erschließt sich erst einer Einstellung, die wir hier als ‚Negative Semiologie‘ kennzeichnen können. Die Maxime der Negativen Semiologie ist: Was die Stimme als Medium von Sprache und Kommunikation bewirkt, ist in zeichentheoretischen Termini hinreichend nicht mehr beschreibbar. Die Medienperspektive einzunehmen ist also ein Versuch, die in der Semiosis nicht aufgehenden Dimensionen der Lautlichkeit zutage treten zu lassen. Daher läuft die Medienperspektive – in letzter Konsequenz – darauf hinaus, die uns selbstverständliche Idee, sprachliches Tun mit einem Zeichenhandeln zu identifizieren, zu relativieren.
- Das genannte "Durchbrechen" ist ein eigentümliches Konstrukt. Es enthält das Motiv der Doppelverwendung (siehe oben) und der Ermöglichung. Es gibt Situationen, in denen "hört man, dass jemand es ehrlich meint". Darauf kann man verweisen, wenn man die Beschränktheit der Diskursivität aufzeigen will. (Es fragt sich dann allerdings auch, wie verlässlich solche Konstruktionen sind.) Eine "tiefer gelegene Dimension" "kommt zum Vorschein". Aber das durchbricht die Signifikanz nur lokal. Ein ganz anderer Begriff des "Durchbrechens" ist die Ermöglichung von Signifikanz. Und hier darf man nicht verwechseln:
- die methodische Frage nach einer begründenden Dimension/Instanz
- die faktische Bindung des Sprechens an das Leben
- Das genannte "Durchbrechen" ist ein eigentümliches Konstrukt. Es enthält das Motiv der Doppelverwendung (siehe oben) und der Ermöglichung. Es gibt Situationen, in denen "hört man, dass jemand es ehrlich meint". Darauf kann man verweisen, wenn man die Beschränktheit der Diskursivität aufzeigen will. (Es fragt sich dann allerdings auch, wie verlässlich solche Konstruktionen sind.) Eine "tiefer gelegene Dimension" "kommt zum Vorschein". Aber das durchbricht die Signifikanz nur lokal. Ein ganz anderer Begriff des "Durchbrechens" ist die Ermöglichung von Signifikanz. Und hier darf man nicht verwechseln:
- Wenn es aber so ist, daß die phonetische Schrift zur Modellbildnerin ‚der‘ Sprache wird, – dann werden sich gerade im Begriff des ‚Lautes‘ bzw. des ‚Phonems‘ von Anbeginn Merkmale eingeschrieben haben, die nicht diejenigen der akustischen Stimme, vielmehr der visuellen Schrift sind. Die abendländische Konzeption vom Sprachlaut – das jedenfalls ist die Vermutung – ist geprägt von einem impliziten Skriptizismus. Wir können diesen Gedanken hier nicht weiter verfolgen. Uns kommt es nur auf eine Facette an, die darin besteht, daß mit der Skripturalisierung des Sprachlautes seine Entmusikalisierung eingeleitet ist. Mit der Dazwischenkunft der phonetischen Schrift wird die Sprache ihrer musikalischen Dimension entkleidet. In dieser Perspektive zeugt die Marginalisierung der Stimme daher auch von einer Eskamotierung – oder sollten wir sagen: Verdrängung? – des Musikalischen aus dem mündlichen Sprachgebrauch. Und umgekehrt: Eine Rehabilitierung der Stimmlichkeit heißt dann, die musikalische Dimension am und im Sprechen wiederzugewinnen. Das also, worin die ‚negative Semiologie der Stimme‘ die Semiotik der Sprache aufbricht, liegt in der Musikalität des Sprechens.
PopScriptum: Wolfgang Ernst
Zum Begriff des Sonischen (mit medienarchäologischem Ohr erhört/ vernommen)
- Um bei der Analogie zur schriftlichen Kodierung des Akustischen zu bleiben: Klang ist komplex wie ein Wort, zusammengesetzt aus Einzeltönen. Für den Akustiker ist Klang "eine hörbare periodische Schwingung, die sich im Ggs. zum Ton, gemeint ist dann der Sinuston, aus mehreren Teilschwingungen zusammensetzt" [2]. Damit kommt die frühe elektroakustische Musik (die zunächst einfache Schwingungen, reine Sinustöne oder sinuide Artikulationen produziert) vom Ton her.
- Für den Transport von Schallwellen ist ein Medium erforderlich; Die Encyclopaedia Britannica (2003) definiert Sound als "Mechanical disturbance from a state of equilibrium that propagates through an elastic material medium". Wellen breiten sich in gekoppelten Systemen (etwa Luftpartikel) per Übertragung des Impulses an Nachbarteilchen aus.
- Auf physikalischer Ebene ist Klang kein Medium; Medium ist hier (wie von Aristoteles in Peri psyches als "to metaxy", als "Dazwischen" beschrieben) vielmehr die Luft, in der sich Klang überträgt. Natürlicher oder kultureller Klang also ist im physikalischen Medium. Doch im Sinne der Definition von Fritz Heider (1926), demzufolge Medium alles ist, was als lose Kopplung zu einer festen informiert werden kann, ist Klang etwa Medium für Musik - ein relationaler Medienbegriff, nach zwei Seiten hin verschiebbar. [3]
- Elektromagnetische Wellen aber setzen solch ein Feld selbst, behandelt also nicht das physikalisch schon Vorliegende, sondern erschaffen es nach eigenem medien- (und nicht schlicht kultur-)technischen Recht.
- Ausdrücklich im Anschluß an eine Forderung der künstlerischen Avantgarde der Moderne, an Kunstwerken nur das Medienspezifische aufscheinen zu lassen, formulierte McLuhan 1964: das Medium sei die Botschaft. Die Abkehr der modernen Kunst von der Referentialität zeigt das jeweils eingesetzte Medium, das sich üblicherweise hinter der intendierten Mitteilung verbirgt, wie es ist: "Aus der Poesie sollte alles Narrative und Bildhafte entfernt werden, um den reinen Klang der Sprache hörbar zu machen; aus der Musik sollte alles Imitative und Melodisch-Narrative entfernt werden, um den reinen Klang hörbar zu machen." [4]
- Eine Theorie des "Sonischen", wie sie Peter Wicke als Ebene zwischen elaborierter Musik und rein physikalischer Akustik entwickelt, meint auditive Wahrnehmung als schon determinierte, gefiltert durch kulturelle, negentropische Muster von Wahrnehmung, die "kulturelle Formatierung von Klang". [5] Sonik zieht - diesen Ansatz weitertreibend - den Kreis noch enger und meint die technologische Eskalation und Autonomisierung dieser Wahrnehmungssphäre: die Emanzipation von der kulturellen oder anthropologischen Bindung des Klangs, als gegenüber Stimme und Instrument klangkörperlos, ja mathematisch gewordener Klang - der dann umso emphatischer wiedereinkehrt.
- Musikalische Theorie unterscheidet von alters her zwischen dem äußerlich Wahrnehmbaren und dem nur innerlich Einsichtigen. Dieses Innerliche ist keine metaphysische oder idealistische Kategorie, sondern einerseits eine Funktion kulturtechnischer Prägungen; andererseits gibt es eine innere Einsichtigkeit klanglicher Prozesse, die nur noch Meßmedien gegeben ist.
- Der Begriff des "Sonischen" unterläuft die (dualistische) Zweiteilung in eine "Theorie des Schönen" (philosophische Ästhetik) und eine "Theorie der Wahrnehmung" (aisthesis). In Differenz zur philosophischen Ästhetik ist das Sonische eindeutig auf der Seite des Aisthetischen anzusiedeln.
- Diogenes von Seleukeia unterschied zwischen einer naturgegebenen und einer geschulten Wahrnehmungsfähigkeit, einer autophyés aísthesis und einer epistemoniké aísthesis [6]; es gibt eine asemantischen Wahrnehmung von Musik. Doch etwas Anderes meint mediengenerierte Sonik im engeren Sinne - der ganze Unterschied von Kulturtechniken und Technologien. Das medienarchäologische Ohr läßt sich nicht wahllos auf alles ein, was klingt, sondern hört verschärft (akouein): Wie funktioniert Klang aus und in techno-mathematischen Medien? Hier öffnet sich eine Differenz zwischen der sonischen Qualität des medieninduzierten Klangs und dem, was kulturell-diskursiv geprägt wurde. Mit dem techno-mathematischen Medienbegriff wird eine sonische Qualität faßbar, die komplexer ist als das rein akustische Material und die Mechanik der Instrumente. Das Sonische ist durch das akustische Material zwar vorgegeben, aber damit nicht hinreichend definiert. Dies meint noch nicht Musik, aber mehr als nur pure Physikalität.
- Roland Barthes differenziert gegenüber dem manifesten Phäno-Gesang den latenten Geno-Gesang als den Raum, in dem die Bedeutungen aus dem Inneren der Sprache und in ihrer Materialität selbst hervorkeimen; "ein signifikantes Spiel, das nichts mit Kommunikation, Repräsentation (der Gefühle) und Ausdruck zu tun hat; es ist die Spitze (oder der Grund) der Produktion, wo die Melodie wirklich die Sprache bearbeitet - nicht das, was sie sagt, sondern die Wollust ihrer Ton-Signifikanten, ihrer Buchstaben." [7] Ebenso verhält es sich mit dem Sonischen: Es meint eine Ebene musischer Kulturtechniken, nicht reduziert auf die Medialität im Sinne des akustischen Kanals. Eine Kulturgeschichte des Sonischen aber, wenn sie in einem signaltechnischen Apriori verankert wird, ist nicht mehr Kulturwissenschaft, sondern Medien- als Signalanalyse. Der Begriff des Sonischen verhilft dazu, Musik nicht einseitig auf das Semiotische zu reduzieren. Mit Klang kann man mehr generieren als Musik oder Kommunikation. Einen Schritt dahin (und weiter) geht Jacques Attali, der Sonosphären unter dem Begriff analysiert, die sie unterlaufen: Bruits. [8]
- Auf der Suche nach dem Dazwischen von Musik und Klang treffen wir auf das Sonische. Friedrich Kittlers erster Band der geplanten Reihe Musik und Mathematik (München 2006) sagt es: Es gibt nur eine Kultur, die Physik erfunden hat als das, was klingt: das Erbe Altgriechenlands. Klang ist in unseren Ohren also selbst kulturell spezifisch. Akustik meint physikalische Phänomene; die Filterraster des Akustischen aber sind kulturell. Das Sonische ist damit zwar ein dem naturwissenschaftlichen Ohr verpflichteter Begriff, aber mit historischem Index versehen.
- Musik, als eine klangvermittelte Kulturtechnik gelesen, stößt uns zunächst auf historische Filtervorgänge. Ein Ton mit der Frequenz von 440 Herz ist ein akustisches, kein musikalisches Ereignis; es macht den Ton A (und fungiert gleichzeitig als Kammerton, als medienakustischer Standard zur Stimmung von Instrumenten). Tatsächlich passiert hier ein Strom physikalischer Materie, doch 440 Hz existieren nicht natürlich, sondern sie sind eine technische Abstraktion und sind als Kammerton A immer schon ein diskursiv diskretisiertes Ereignis.
- Eine Frequenz von 1960 ist etwas anderes als eine Frequenz 1990, kulturell vernommen. Das Sonische meint die historisierten Formen / Operatoren des Akustischen (Martin Carlé). Eine Geschichte des Klangs als Medium von Musik zielt auf ein dazwischenliegendes Niveau: nicht die reine Physikalität des Akustischen, aber auch nicht die Hochkultur von Musik.